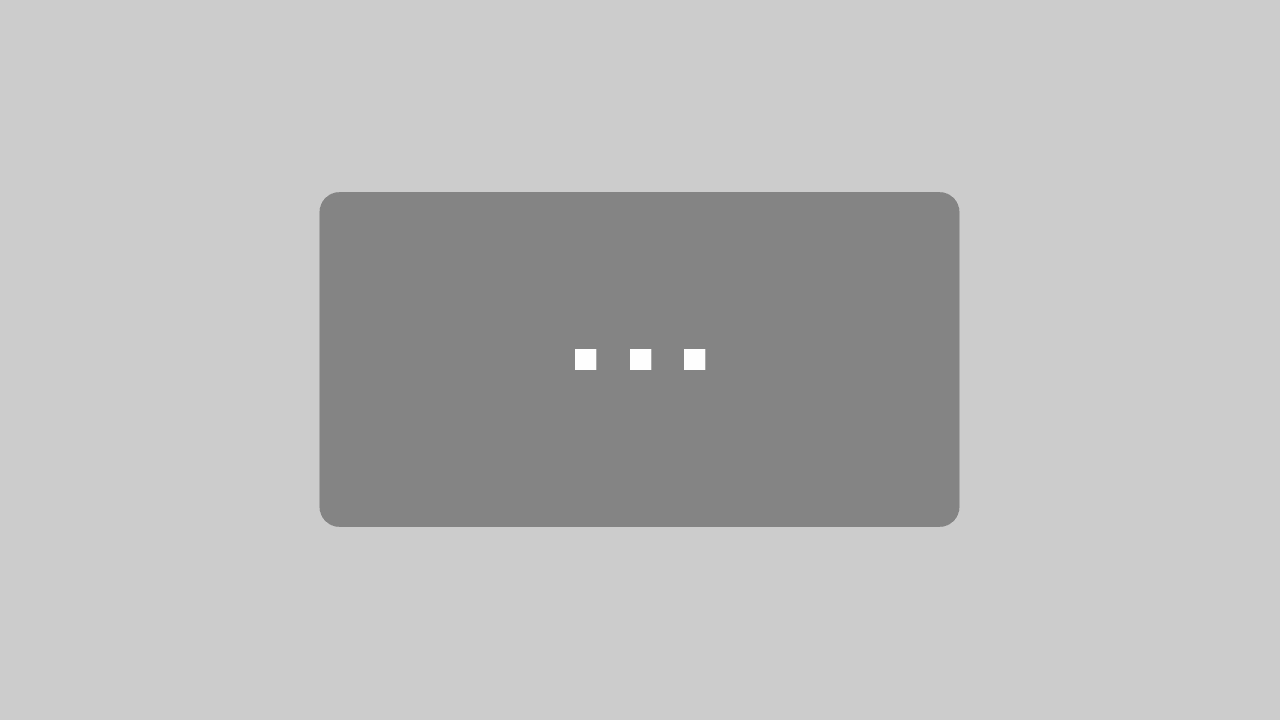Er packt den Gegner an seinen stärksten Argumenten, ist ein radikaler Egalitarist und nennt sich zugleich einen Konservativen. Er hat einen Blick für die eigenen Wurzeln und für das Thema der Gemeinschaft. Er legt eine große Ernsthaftigkeit für die ihm wichtigen Themen an den Tag, aber hat einen ausgeprägten zuweilen bissigen Humor. Durch alles zieht sich ein großer Optimismus, dass die Menschheit in der Lage sein wird, Gesellschaft human zu organisieren, so dass alle Menschen sich entfalten können. Eine (neuerliche) Hommage zu G. A. Cohens 80. Geburtstag.
Als Gerald A. Cohen im Jahr 2016 75 Jahre alt geworden wäre, fand ich damals, dass in den Feuilletons der großen Zeitungen Würdigungen gedruckt werden müssten, um diesen in Deutschland viel zu wenig bekannten politischen Philosophen zu feiern. Heute würde „Jerry“ Cohen 80 werden und vermutlich wird auch dieser etwas rundere Geburtstag nicht für allzu viel Aufmerksamkeit sorgen.
Schon des Öfteren haben mich Freunde (mit Augenzwinkern) einen „Fanboy“ genannt, weil ich bei bestimmten Themen ständig mit Cohen ankomme. Und ein bisschen finden sie es auch sympathisch, dass ich meinen Lieblingsdenker habe, der mich über so lange Zeit begleitet. Aber natürlich habe ich mich selbst auch schon kritisch gefragt, woher das eigentlich kommt, dass ich mich so für diesen Philosophen begeistern kann.
Ein Teil dürfte Zufall und Prägung sein: Cohen lehrte bis zu seinem Tod 2009 in Oxford, wo ich zeitgleich studierte. Ich besuchte ein Seminar bei ihm (als schüchterner Undergraduate zu Gast zwischen lauter Doktorand*innen) und ich hatte eine ganze Reihe Dozent*innen, die von Cohen beeinflusst worden waren. In der politischen Theorie war Cohen in Oxford zu dieser Zeit sehr präsent. Und: Sein Tod während meines Studiums dort bewegte mich und so entstand vielleicht eine besondere Bindung, die bis heute hält.
Wie rational begründet mag eine Position sein, die durch Sozialisation erklärbar ist?
Aber das kann nicht alles sein, allein schon, weil es zu der Zeit auch andere kluge und einflussreiche Wissenschaftler*innen gab, die mich weniger beeindruckt haben. Ein bisschen ist man bei dieser Frage auch schon mitten im Denken Cohens, denn ihn selbst interessierte, wie wichtig eigentlich die eigene Geschichte – Wurzeln und Prägung – für individuelle Überzeugungen und für die jeweilige Art, an philosophische Probleme heranzugehen, seien.
Cohen entstammte einem kommunistisch-jüdischen Milieu in Montreal, Canada – und Zeit seines Lebens beschäftigten ihn Fragen, die sich um Werte wie Gleichheit, Gemeinschaft, Gerechtigkeit und die Bedingungen menschlicher Selbstverwirklichung drehen. Und er studierte in Oxford Philosophie und lernte dort die analytische Methode seines Lehrers Gilbert Ryle, die (mit den Hilfsmitteln der formalen Logik) aus Intuitionen und konkreten Beispielen abstrakte Prinzipien ableite. Diese stehe, so spitzt Cohen selbst es zu, im Kontrast zum Ansatz des „Harvard Style“, beispielsweise von John Rawls, dessen Ausgangspunkt abstrakte Prinzipien seien.
In einer Vorlesungsreihe geht Cohen gezielt diesen eigenen Wurzeln auf den Grund, und stellt ganz offensiv die selbstkritische Frage, wie es möglich sein könne, Überzeugungen für rational begründet zu halten, wenn diese Überzeugungen durch die eigene Sozialisation erklärbar seien. In dieser Vorgehensweise liegt bereits einer der Gründe für meine Begeisterung für diesen Denker: er ist bereit, eigene Überzeugungen kritisch ins Licht zu halten, und nutzt dies dann ganz offensiv als Methode, um diese Positionen wiederum zu schärfen.
Deeper into bullshit
Dabei ist er ein harscher Kritiker von sogenanntem Bullshit. Nicht jeder Gedanke könne gleich auf Anhieb zu Ende gedacht sein. Inakzeptabel ist es aber für Cohen, wenn man aus intellektueller Faulheit Gedanken nicht schärft oder zu schärfen bereit ist. Dies warf er besonders Vertreter*innen der speziell in Frankreich verbreiteten „Continental Philosophy“ und des Marxismus vor.
Cohen ist Mitbegründer der sogenannten „September Group“ von Non-Bullshit-Marxisten, die sich in den 1980er-Jahren jährlich im September trafen und Fragen des Marxismus mit den Mitteln analytischer Philosophie diskutierten. Das Spaß-Wappen der Gruppe: Ein Verbotsschild mit einem durchgestrichenen, scheißenden Bullen. Dazu eine Banderole mit der lateinischen Aufschrift: „Marxismus sine stercore tauri“.
Ein guter Vorab-Test dafür, ob etwas Bullshit sei: Wenn die Plausibilität eines Satzes keine Veränderung dadurch erfahre, dass man das Vorzeichen dieses Satzes ändere – also den Satz einmal bejahe, einmal verneine.
Dabei nutzt Cohen den Bullshit-Vorwurf jedoch nicht als destruktive Killerphrase, mit welcher man es in unaufklärerischer Absicht auch auf Diskursherrschaft abgesehen haben könnte. Im Gegenteil, er ermutigt dazu, unausgereiften Gedanken eine Chance zu geben – dabei aber immer nach Klarheit zu streben:
One should aspire to clarity, but one should not avoid possible insight for the sake of avoiding unclarity. A bad way never to make a mistake is to shut up and say nothing.
G. A. Cohen: How to Do Political Philosophy, in: On the Currency of Egalitarian Justice, S. 226
Anders als vielleicht mancher analytische Philosoph betreibt Cohen zugleich nicht bloße Begriffsklauberei und ein belangloses Verfeinern von Definitionen. Cohen nutzt seine analytische Brillanz zur Klärung von substantiellen Fragen, solchen mit gesellschaftlicher Relevanz: wie gut ist der Kapitalismus geeignet, allen Menschen eine Selbstverwirklichung zu ermöglichen? Welche Ressourcenungleichheit kann überhaupt gerecht sein? Ist das möglichst unbeschränkte Recht auf Privateigentum ein überlegener Garant für Freiheit? Welcher Wert liegt im Bewahren? Und was ist eigentlich Sozialismus?
Cohen verfolgt solche Fragen mit einer analytischen Schärfe und Tiefe, die ich atemberaubend finde. Wenn ich Cohen lese, bin ich dabei besonders langsam. Aber ich habe jedes Mal danach das Gefühl, dass es meinem eigenen Denken gut getan hat, dieser unglaublich präzisen Art zu folgen, mit klarer Sprache und strategischem Aufbau eines Textes wichtigen Fragen nachzugehen. Ein bisschen wie Yoga fürs Hirn.
Cohen ist ein Meister darin, Argumente anderer zu zerlegen. Dabei dosierte er Weggefährten zufolge jedoch in direkten Auseinandersetzungen seine Geisteskraft entsprechend seines Gegenübers. Je stärker und statushöher, desto gnadenloser. Und er animiert junge Philosoph*innen dazu, nicht autoritätshörig zu sein. Nur weil alte Hasen eine vermeintliche Wahrheit für selbstverständlich halten, könne es sehr wohl so sein, dass sie eigentlich etwas Wichtiges übersähen.
Another tip: When you’re doing philosophy, don’t be afraid to sound dumb, or simpleminded. If, for example, what somebody says sounds to you so obviously mistaken that you conclude that you must be missing something, keep alive in your mind the alternative conclusion, which is that they are missing something, or seeing something that isn’t there, even if they are the teacher. Some of the most successful philosophical interventions that I’ve witnessed have been a matter of pointing out that the emperor’s not wearing any clothes.
G. A. Cohen: How to Do Political Philosophy, in: On the Currency of Egalitarian Justice, S. 226
Libertarismus: aufrichtiges Interesse an einer absurden Ideologie
Ein anderes Beispiel für Cohens faszinierendes Denken findet sich in seiner Auseinandersetzung mit dem Libertarismus und dessen zentralen Denker Robert Nozick. Cohen begründet sein Interesse für den Libertarismus und sein politisches Programm eines kapitalistischen Minimalstaats nicht etwa damit, dass er die politischen Schlussfolgerungen absurd und abzulehnen findet. Vielmehr begründet er sein Interesse damit, dass er eine Verwandtschaft der Annahmen des Libertarismus mit eigenen, im Marxismus wurzelnden ausbeutungskritischen Positionen sieht. Eine Verwandtschaft, die ihn angesichts der gegenteiligen politischen Schlussfolgerungen intellektuell verstört und der er auf den Grund gehen möchte.
Cohen löst diesen Widerspruch auf, indem er zeigt, dass der Libertarismus eigentlich kein Programm der Freiheit sei, sondern ein Programm der „Self-Ownership“, das sich nur der Freiheitsrhetorik bediene und damit attraktiver erscheine als es tatsächlich sei. Dem Self-Ownership-Prinzip zufolge genieße jeder Mensch das volle und exklusive Recht über sich selbst und alles, was aus eigenen Kräften hergestellt wurde. Daher der absurde Slogan, Besteuerung sei Sklaverei. Doch das politische Programm des Nachwächterstaats und der Ablehnung von Umverteilungspolitik, bringe – so Cohen – am Ende gar nicht die Freiheit und Autonomie, die dessen Kernprinzip der Self-Ownership suggeriere.
Dekonstruktion der Freiheitsrhetorik im Sozialliberalismus
Cohen ist bei alledem nicht nur ein redlicher Kritiker, sondern auch ein kluger: er möchte sich nicht an Strohmännern abarbeiten, sondern sucht gezielt starke Argumente in den kritisierten Positionen und versucht diese möglichst in ihrer eigenen Sprache zu überführen. So kommt er dem Libertarismus auch nicht als erstes mit Gerechtigkeit oder dem Vorwurf abstruser politischer Schlussfolgerungen, die wiederum auf externen Prämissen fußen würden (und welche Anhänger des Libertarismus vermutlich gar nicht teilen würden), sondern mit dem Freiheitsbegriff höchstselbst, den er als inkonsistent bezeichnet.
Zugleich ist Cohen auch politischer Stratege, denn er erkennt, dass zwar der radikale Libertarismus mit „t“ außer bei ein paar Verirrten und Privilegierten kaum attraktiv erscheinen mag, dass aber der seinerzeit und bis heute dominante (Sozial-)Liberalismus (ohne „t“) demselben inkonsistenten Gebrauch des Freiheitsbegriffs unterliege wie seine marktradikale Schwester-Ideologie. Und so nutzt er die Dekonstruktion des politisch irrelevanten Libertarismus, um den politisch relevanten (Sozial-)Liberalismus auf sein problematisches Freiheitsverständnis aufmerksam zu machen.
Für mich hat niemand diesen sehr weitverbreiteten, irreführenden Gebrauch des Freiheitsbegriffs brillanter seziert als Cohen. Wir kennen es alle: Umverteilung? In Maßen vielleicht gut, aber bloß nicht zu viel, denn sonst schränken wir die Freiheit zu sehr ein. Das häufige Credo: Man müsse eine gute Mitte finden zwischen Umverteilungspolitik und der Einschränkung von Eigentumsrechten.
Cohen deckt auf, dass dem hier zugrunde liegenden Freiheitsbegriff eine einseitige, halbblinde Betrachtung zugrunde liegt: Sie sieht immer nur die Freiheitseinschränkung, die ja tatsächlich für die Eigentümer*innen vorliegt, wenn wir Eigentumsrechte (beispielsweise durch Besteuerung) berühren. Aber sie übersieht systematisch die permanente Freiheitseinschränkung bei demselben Eigentum, die gleichzeitig für alle Nicht-Eigentümer*innen (durch das geschützte Recht auf das Eigentum) Realität ist.
Wichtig: es geht Cohen zunächst nicht um eine normative Bewertung, sondern darum, eine inkonsistente Position aufzudecken. Denn Libertäre wie Liberale koppelten den Freiheitsbegriff an das Eigentumsrecht und wollten ihn aber nach Belieben zugleich in einem neutralen Sinne verwenden. Das gehe nicht beides zusammen.
Sie verteidigten normativ das Eigentumsrecht, weil es – so sagen sie – ein Garant von Freiheit sei. Hier meinten sie Freiheit dann aber auf einmal ganz neutral, losgelöst von den Eigentumsrechten, in eben jenem Sinne als „Abwesenheit von Einschränkung“, der uns allen erst einmal ohne weitere Zusätze als attraktiv erscheinen muss.
Und hier sagt Cohen zurecht, dass Libertäre und Liberale nicht gleichzeitig diesen neutralen Freiheitsbegriff auf das Eigentumsrecht pachten könnten, wenn sie nicht bereit wären, ihn ebenfalls zu nutzen, um die Freiheitseinschränkung anderer durch dieses selbe Eigentum ebenso deutlich zu machen. Das gehöre rein logisch dazu, wenn Freiheit in diesem neutralen Sinne verwendet werde.
Cohen wägt an dieser Stelle noch gar nicht einen möglichen Nutzen von Eigentumsrechten als gesellschaftlicher Institution ab, und genau so wenig sagt er, Besteuerung und Umverteilung garantiere per se mehr Freiheit. Eine Frage, die sich vermutlich in der Theorie auch kaum klären lässt. Aber er rettet den Freiheitsbegriff zunächst einmal aus den Klauen der Liberalen und Libertären, die mit ihm – bewusst oder unbewusst – Umverteilungspolitik als per se freiheitsfeindlich delegitimieren.
Cohen als Konservativer
Cohen ist bekannt als analytischer Marxist – auch wenn er sich im Laufe seiner philosophischen Entwicklung zunehmend von Marx freigemacht hat. Auch ist er bekannt als radikaler Egalitarist – der Gerechtigkeit als Abwesenheit von unfreiwilligen Nachteilen verstanden hat, viel weniger tolerant gegenüber Ungleichheit als zum Beispiel John Rawls, der oft als „linker“ Gerechtigkeitstheoretiker bezeichnet wird. Da mag es überraschen, dass sich Cohen auch als Konservativen bezeichnete, eine von anderen Strängen scheinbar eher losgelöste Gedankenbaustelle, die er leider nie ganz systematisch zu Ende brachte.
Cohen leitet den Essay mit seinem ihm typischen Humor als Witz ein:
— “Professor Cohen, how many Fellows of All Souls [Wissenschaflter*innen seines Colleges in Oxford] does it take to change a light bulb?”
— “Change?!?”
Cohen bezeichnet sich dabei allerdings als „small-c“ conservative, einer der nur gerne bewahre, was intrinsischen Wert habe – und Ungerechtigkeit, die „large-C“ Conservatives typischerweise in Form von Einkommens- und Vermögensungleichheit bewahren wollten, fehle dieser Wert. Es ist eine Seite, ein viel spekulativeres und weniger selbstsicheres Denken, das Cohen für mich noch sympathischer macht. Und ich kann dieser konservativen Haltung in nicht-gerechtigkeitsbezogenen Fragen einiges abgewinnen.
Solidarity forever
Eine weitere Seite, die meine Begeisterung für den Cohen jenseits des analytischen Genies erklärt, ist seine Leidenschaft für die Musik der Arbeiterbewegung, die an verschiedensten Stellen in seinem Werk und Wirken deutlich wird.
Als Eingangszitat eines Artikels zu Ausbeutungsbegriff und Arbeitswertlehre (der übrigens allein schon lesenswert ist, weil er eine wunderbare und zugleich kompakte Illustration von Cohens analytischer Methode ist) bringt Cohen beispielsweise Zeilen aus dem traditionellen Gewerkschafts-Lied „Solidarity Forever“ von Ralph Chaplin:
It is we who ploughed the prairies, built the cities where they trade,
Dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid,
Now we stand outcast and starving, ‘mid the wonders we have made…
Und in dem kurz vor seinem Tod geschriebenen Essay “Why not Socialism?” zitiert er ein Lied seiner Kindheit:
I continue to find appealing the sentiment of a left-wing song that I learned in my childhood, which begins as follows: “lf we should consider each other, a neighbor, a friend, or a brother, it could be a wonderful, wonderful world, it could be a wonderful world.”
G. A. Cohen (2009): Why Not Socialism?, S. 51
So verbindet sich das Thema der Gemeinschaft für Cohen in seiner Begeisterung für diese Lieder und in seinen Überlegungen zum Sozialismus. Gemeinschaft, manchmal spricht er auch von Brüderlichkeit („fraternity“), erfordere insbesondere eine menschliche Haltung, mit der andere und deren Wohlergehen einem nicht egal seien, mit der man sich wo möglich und nötig für andere einsetze, und mit der es einem auch nicht egal sei, ob Menschen sich füreinander einsetzten.
Ohne ein gewisses Maß an Gemeinschaft, so Cohen, könne Sozialismus nicht funktionieren. Zugleich entwickelt Cohen aus diesem Gedanken eine scharfe Kritik am weniger radikalen Egalitarismus von John Rawls, dem er vorwirft in sich nicht stimmig zu sein, wenn einerseits die Theorie einen egalitären Ethos benötige und zugleich aber Privilegien, die Anreize für Einzelne zu einem Verhalten zum Wohle aller setzen sollen, als notwendig und gerecht erachtet werden.
Unvergessen bleibt für mich die Trauerfeier ein Jahr nach Cohens Tod in der Bibliothek von All Souls College (deren Beiheft mit sehr persönlichen Beiträgen unter anderem von den Weggefährten John Roemer und Philippe van Parijs unbedingt lesenswert ist). In einer sehr bewegenden Zeremonie wurde gemeinsam im Saal, unter Anleitung des College-Warden John Vickers (einem in der Volkswirtschaftslehre anerkannten Wettbewerbsökonomen (!), der damals die Einführung in die Makroökonomik im Bachelor gab) die schon erwähnte Gewerkschaftshymne „Solidarity Forever“ gesungen.
Wer je das Buch „If You’re an Egalitarian, How Come You’re So Rich?“ von Cohen in die Finger bekommt, sollte unbedingt einen Blick in Vorlesung Nummer 7 werfen. Mehr möchte ich nicht verraten.
Mit dem Shmoo gegen den Kapitalismus
Bei alledem war Cohen auch einfach ein ziemlich humorvoller Mensch. Auf Youtube kann man Videos von Cohen anschauen, in denen er sich über seine eigene Philosophen-Zunft lustig macht und Marx-Texte ins Skurrile zieht. Beispielsweise inszeniert er auf dem Sofa einen fiktiven Boxkampf zwischen „Jürgie Bürgy Habermas“ und „John the Kid Roemer“, als sei er, Cohen, der Kommentator dieses fesselnden Wettkampfs.
Ein anderes Video von Cohen sei hier zum Abschluss verlinkt. Es zeigt Cohen in einer Fernsehreihe des britischen TV-Senders „Channel 4“ aus den 1980er-Jahren zum Kapitalismus, wie er mit der Comic-Figur des „Shmoo“ als Gedankenstütze gegen den Kapitalismus argumentiert, in einem 25-minütigen Parforce-Ritt, ohne Unterbrechung, druckreif.
Cohen kritisiert den Kapitalismus darin unter anderem für seine Tendenz, Menschen in den Zwängen einer konsumistischen Tretmühle einzusperren, in der sie getrieben von Statusvergleichen und sozioökonomischem Druck mehr arbeiteten als nötig wäre, um Grundbedürfnisse zu befriedigen. Dies lässt sich auch als eine weitsichtige ökologische Kritik am Kapitalismus lesen.
Cohen kritisiert, dass das Bildungssystem primär dazu ausgerichtet sei, Menschen für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren, und nicht, sie in ihrer eigenen Selbstentfaltung und Verwirklichung ihrer Talente zu stärken. Eine solche Selbstverwirklichung sei weiterhin ein Privileg weniger.
Doch Cohen ist zuversichtlich, dass nach der Errungenschaft einer Demokratisierung der Politik, die wir heute vielerorts als selbstverständlich erachten, auch die Sphäre des Wirtschaftens demokratisiert werden könne.
Cohen erkennt dabei die historische Bedeutung des Kapitalismus an, technologischen Fortschritt in rasantem Tempo zu begünstigen. Aber zugleich sagt er, dass die Menschheit bislang den Ausstieg verpasse, nun die Bedingungen menschlicher Entfaltung für alle zu schaffen, welche rein technologisch bei gleichzeitiger Befriedigung der Grundbedürfnisse möglich sein müssten.
Dabei ist er an anderer Stelle durchaus ehrlich, dass auch er (noch) keine Antworten habe, wie genau ein solche Wirtschaftsordnung – für ihn ist es Sozialismus – aussehen sollte. Inspirierend ist aber allemal sein Optimismus, dass dies möglich sei, und sein Glauben, dass die Menschheit diesen Weg finden werde:
Teil 1:
Teil 2: